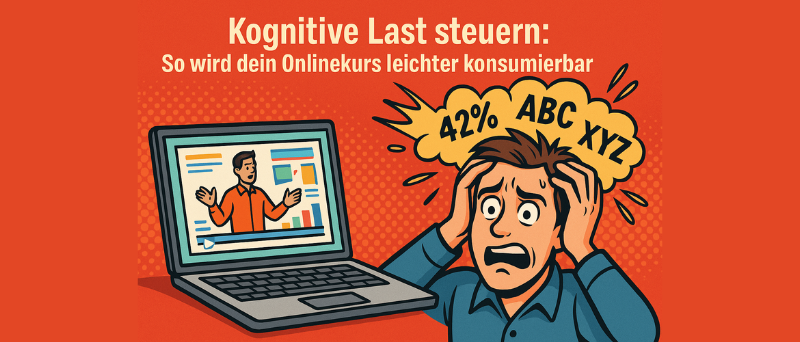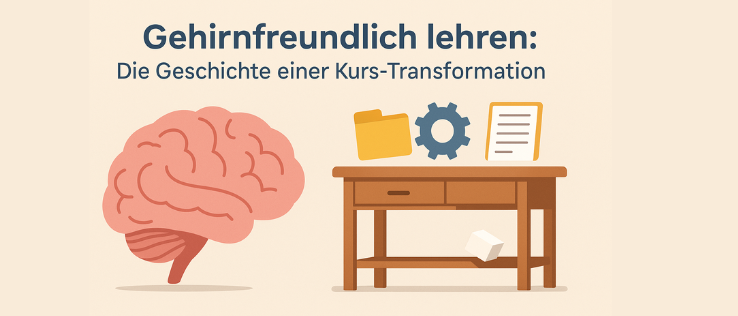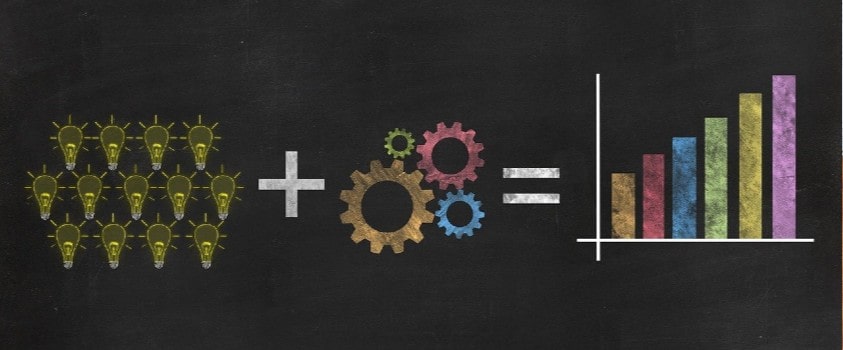Kognitive Last steuern: So wird dein Onlinekurs leichter konsumierbar
Stell dir vor, du sitzt an einem Dienstagabend vor deinem Laptop. Du hast dich auf die neue Lektion in einem Onlinekurs gefreut. Der Titel klingt spannend. Du klickst auf „Play“.
Das Video startet. Eine animierte Intro-Musik, bunte Folien, der Trainer redet schnell. Zahlen, Fachbegriffe, Abkürzungen prasseln auf dich ein. Du versuchst mitzuschreiben, springst zurück, spulst vor, schaust dir die Grafik nochmal an.
Nach zehn Minuten merkst du: Dein Kopf ist voll – und du hast keine Ahnung mehr, was am Anfang gesagt wurde.
Wenn deine Teilnehmer dieses Gefühl haben, verlierst du sie. Nicht, weil dein Inhalt schlecht ist. Sondern weil ihre kognitive Last zu hoch war.
Was kognitive Last ist – und warum sie zählt
Die Cognitive Load Theory (CLT), entwickelt von John Sweller in den 1980er Jahren, beschreibt, wie das menschliche Arbeitsgedächtnis funktioniert – und wo seine Grenzen liegen.
Vereinfacht gesagt: Dein Gehirn hat eine Art „Arbeitsfläche“. Auf dieser Arbeitsfläche kannst du nur eine begrenzte Anzahl an Informationen gleichzeitig halten und verarbeiten.
Sweller unterscheidet drei Arten von kognitiver Last:
- Intrinsische Last – das ist die Komplexität des Stoffes selbst. Anatomie für Medizinstudenten ist komplexer als Grundfarben für Kunstanfänger.
- Extrinsische Last – alles, was unnötig zusätzlich belastet: unübersichtliche Folien, irrelevante Exkurse, technische Hürden.
- Germane Load – die positive Denklast, die beim Lernen hilft. Zum Beispiel, wenn Teilnehmer aktiv versuchen, Zusammenhänge zu erkennen oder das Gelernte in ihr eigenes Wissensnetz einzuordnen.
Dein Ziel als Kursleiter ist klar:
- Extrinsische Last senken – unnötige Belastung rausnehmen.
- Germane Load fördern – Aufgaben einbauen, die Verarbeitung und Anwendung unterstützen.
Unnötiges entfernen – das Coherence Principle
Richard Mayer, einer der führenden Forscher im Bereich Multimedia Learning, hat das Coherence Principle formuliert: Alles, was nicht direkt zum Lernziel beiträgt, gehört raus.
Was das heißt:
- Keine Deko-Grafiken, die nur „schön“ sind, aber nichts erklären.
- Kein Fachjargon, der nicht gebraucht wird.
- Keine langen Einleitungen, die den Punkt hinauszögern.
Warum das wirkt:
Wenn unnötige Reize wegfallen, hat das Gehirn mehr Ressourcen für die relevanten Informationen. Sweller (2011) beschreibt, dass allein das Entfernen irrelevanter Inhalte die Behaltensleistung um bis zu 40 % steigern kann.
HELIX-Quick Win:
Prüfe ein Modul deines Kurses. Streiche alles, was keinen direkten Bezug zum Lernziel hat. Miss danach, ob sich die durchschnittliche Wiedergabedauer pro Video erhöht – oft brechen Teilnehmer später ab, wenn der Inhalt fokussierter ist.
Aufmerksamkeit lenken – das Signaling Principle
Das Signaling Principle besagt: Markiere bewusst, was wichtig ist.
In der Praxis:
- Farblich markierte Keywords in Folien.
- Pfeile, Rahmen oder Icons als visuelle Wegweiser.
- Verbal: „Das ist entscheidend für …“
Warum das wirkt:
Mayer (2009) zeigt in mehreren Studien, dass Signale das Arbeitsgedächtnis entlasten, weil sie Orientierung geben. Das Gehirn weiß, wo es genauer hinschauen soll.
HELIX-Quick Win:
Setze pro Video maximal drei visuelle oder verbale Signale. Tracke, ob Quiz-Antworten zu diesen markierten Inhalten häufiger korrekt sind.
Nähe schaffen – Contiguity Principles
Es klingt banal, aber es ist ein Gamechanger: Zusammengehöriges muss auch räumlich und zeitlich nah beieinander sein.
Räumlich: Platziere Beschriftungen direkt neben das Element, das sie beschreiben – nicht am Rand der Folie.
Zeitlich: Erkläre eine Grafik, während sie zu sehen ist – nicht erst zwei Folien später.
Warum das wirkt:
In Mayers Experimenten mussten Lernende, die Erklärungen und Grafiken getrennt bekamen, deutlich mehr mentale Sucharbeit leisten – und behielten 30 % weniger.
In Häppchen servieren – Segmenting & Self-Pacing
Ein 20-Minuten-Video kann in manchen Kontexten funktionieren. In den meisten Onlinekursen ist es jedoch zu lang, um die Aufmerksamkeit und das Arbeitsgedächtnis optimal zu nutzen.
Segmenting Principle: Zerlege komplexe Inhalte in kurze Abschnitte (6–10 Minuten).
Self-Pacing: Gib den Teilnehmern die Kontrolle: Pausieren, zurückspulen, wiederholen.
Warum das wirkt:
Guo, Kim & Rubin (2014) fanden in einer Analyse von Millionen MOOC-Views heraus: Videos zwischen 6 und 9 Minuten hatten die höchste Engagement-Rate.
HELIX-Quick Win:
Teile ein 20-Minuten-Video in drei Segmente und füge zwischen den Teilen kurze Reflexionsfragen ein. Miss Drop-Off-Rate vorher/nachher – du wirst überrascht sein.
Germane Load fördern – mit aktiver Verarbeitung
Hier geht es nicht ums Kürzen, sondern ums Aktivieren. Germane Load entsteht, wenn Teilnehmer das Gelernte verarbeiten müssen.
Beispiele:
- Lückentexte ausfüllen.
- Mindmaps erstellen.
- In eigenen Worten erklären.
- Transferfragen: „Wie würdest du das in deinem Kontext anwenden?“
Warum das wirkt:
Chi & Wylie (2014) beschreiben in ihrer „ICAP“-Taxonomie, dass aktive und konstruktive Lernaktivitäten signifikant mehr Lernerfolg bringen als passives Konsumieren.
HELIX-Quick Win:
Füge in jedes Modul eine Aufgabe ein, die maximal fünf Minuten dauert und direkt nach der Wissensvermittlung stattfindet.
Messen, ob die Last passt
Du kannst kognitive Last nicht nur fühlen, sondern auch messen.
Subjektiv:
- Nach jeder Lektion: „Wie fordernd war diese Lektion?“ (Skala 1–5)
- NASA-TLX (Task Load Index) als vereinfachte Version.
Objektiv:
- Drop-Off-Rate pro Video.
- Häufigkeit von Pausen und Zurückspulen.
- Fehlerquote in Quizfragen.
Praxis-Tipp:
Integriere ein einfaches „Überforderungs-Barometer“ in deinen Kurs. Schon drei Antwortoptionen („zu leicht / genau richtig / zu schwer“) geben wertvolle Hinweise.
Mini-Blueprint: Lastgesteuertes Modul
- Klares Lernziel – ein Satz, der genau beschreibt, was am Ende können werden soll.
- Nur relevante Inhalte – Coherence Principle anwenden.
- Signale setzen – maximal drei pro Segment.
- Grafik & Erklärung gleichzeitig – Contiguity Principle.
- Abschnitte mit Pausepunkten – Segmenting & Self-Pacing.
-
Aktivierungsaufgabe – Germane Load fördern.
Fazit: Leichter lernen, mehr umsetzen
Wenn du kognitive Last in deinem Kurs gezielt steuerst, gibst du deinen Teilnehmern nicht nur Wissen – du gibst ihnen die Chance, es wirklich zu behalten und anzuwenden.
Das ist der Unterschied zwischen einem Kurs, der „durchgeguckt“ wird, und einem, der Leben verändert.
John Sweller hat es einmal treffend formuliert: „Instructional design is not about making information available, it’s about managing cognitive load.“
Mach es deinen Teilnehmern leicht, dir zu folgen – und schwer, dich zu vergessen.