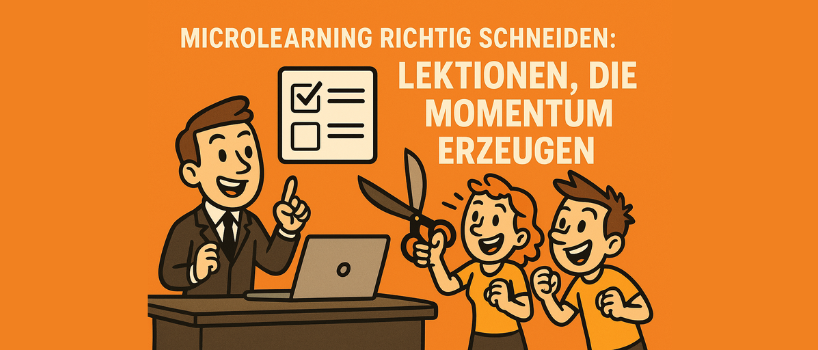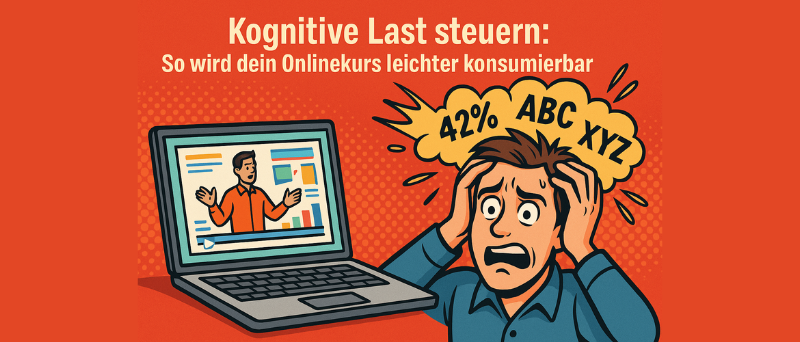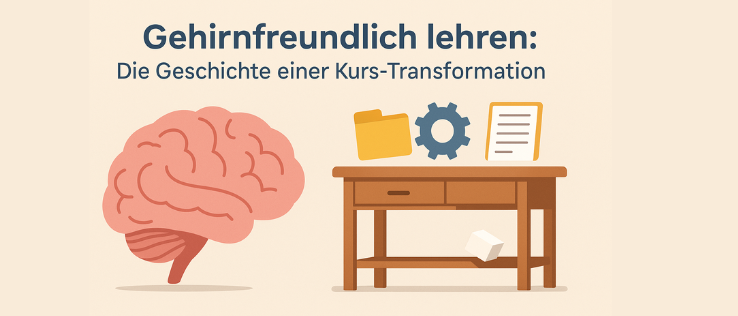Retrieval statt Wiederholen – warum dein Gehirn mehr Training als Streicheleinheiten braucht
Montagabend, Online-Call
Es ist 19:30 Uhr.
Martin, erfahrener Coach für Projektmanagement, sitzt vor seiner Zoom-Kachel und lächelt in die Runde. Die Teilnehmer seines sechswöchigen Kurses nicken eifrig. Heute steht die Zwischenprüfung an – nichts Großes, nur ein kleiner Praxistest.
„Also“, sagt Martin, „stellt euch vor, euer Kunde ruft an und sagt: ‚Wir müssen den Projektplan in drei Tagen umwerfen – wie gehen wir vor?‘ Was ist euer erster Schritt?“
Stille. Kameras frieren in unbequemen Grinsen ein. Schließlich räuspert sich Tanja: „Also… äh… das hatten wir doch… ähm… in Modul 2… oder?“
Martin runzelt die Stirn. Modul 2 hatten alle gesehen. Mehrmals.
Sie hatten die PDFs gelesen. Mehrmals.
Aber jetzt, wo es darauf ankommt, bleibt der Bildschirm leer wie eine frisch gelöschte Whiteboard-Seite.
Und Martin erinnert sich an etwas, das er vor Jahren in einem Buch von Henry Roediger gelesen hatte:
„Vertrautheit ist nicht Erinnerung.“
Die Illusion der Kompetenz
Das Wiederholen hat ein Problem: Es schmeichelt dem Gehirn.
Man blättert durch seine Unterlagen, erkennt die Überschriften wieder, und innerlich denkt ein kleines neuronales Chor: „Kenn ich! Alles klar! Weiter!“
Nur dass dieses „Kenn ich“ nichts über die Abrufbarkeit sagt.
Das ist die Illusion of Competence – wissenschaftlich dokumentiert, unter anderem von Roediger & Karpicke (2006). In ihren Studien fühlten sich die Studenten, die den Stoff mehrfach gelesen hatten, sicherer – schnitten in Tests aber schlechter ab als jene, die sich zwischendurch abfragen mussten.
Metapher gefällig?
Wiederholen ist wie das Anschauen von Urlaubsfotos und die feste Überzeugung, man könne die Route auswendig nachfahren – ohne Karte, ohne Navi. Am Ende steht man doch an einer Kreuzung und fragt sich, ob man links oder rechts muss.
Der Testing Effect in freier Wildbahn
Ich erkläre Martin den Kern: Retrieval Practice.
Aktives Abrufen – also das Ohne-Vorlage-Aus-dem-Kopf-Holen – wirkt wie Muskeltraining für neuronale Pfade.
Jedes Mal, wenn wir eine Information abrufen, verstärken wir die synaptischen Verbindungen, machen sie „breiter“, leichter passierbar.
„Das ist wie bei deinen Kundenprojekten“, sage ich zu Martin. „Wenn sie nur das Prozesshandbuch lesen, ändert sich wenig. Erst wenn sie den Prozess durchspielen, merken sie, wo es hakt.“
In der Forschung hat das sogar einen eigenen Namen: Testing Effect.
Dutzende Studien belegen ihn (Roediger & Karpicke, Dunlosky et al.).
Besonders spannend: Der Effekt ist umso stärker, je länger das Behaltensintervall ist – und er verbessert nicht nur das Erinnern, sondern auch den Transfer: die Anwendung auf neue Probleme.
Desirable Difficulties
„Aber“, wirft Martin ein, „meine Teilnehmer sind oft frustriert, wenn sie etwas nicht wissen. Dann fühlen sie sich dumm.“
„Willkommen bei den Desirable Difficulties“, sage ich und muss lachen. „Robert Bjork hat das so genannt. Der Punkt ist: Lernen darf sich anstrengend anfühlen. Dieses Ziehen im Kopf ist das neuronale Fitnessstudio.“
Der Clou: Fehler sind nicht das Ende – sie sind das Rohmaterial für Korrektur.
Wenn falsche Antworten sofort Feedback bekommen, verstärkt das den Lerneffekt sogar.
Von der Theorie zur Kursstruktur
Martin lehnt sich zurück. „Okay. Aber wie baue ich das in meinen Kurs ein, ohne dass alle denken, ich quäle sie?“
„Ganz einfach“, sage ich. „Du packst die Abrufübungen in kleine Portionen – und verknüpfst sie mit ihrem eigentlichen Ziel.“
Hier kommt die HELIX-Logik ins Spiel:
- Chunking – Kurze, klare Wissenseinheiten.
- Sofort-Retrieval – Gleich danach ein Mini-Quiz oder offene Frage.
- Feedback – Direkt, konstruktiv.
- Spaced Retrieval – Die gleichen Fragen nach 1, 3 und 7 Tagen noch einmal.
- Transfer-Aufgabe – Anwendung auf das eigene Projekt.
Micro-Quizzes
Wir beginnen mit dem Offensichtlichen: Micro-Quizzes nach jeder Lektion.
„Drei bis fünf Fragen reichen“, erkläre ich. „Wichtig: keine Multiple Choice-Inflation. Mindestens die Hälfte offene Fragen.“
Beispiel aus Martins Modul „Risikomanagement“:
„Nenne zwei Maßnahmen, mit denen du das Projektrisiko frühzeitig reduzieren kannst.“
Die Teilnehmer tippen, ohne in die Unterlagen schauen zu dürfen. Danach gibt es sofort die Musterantwort – nicht als Urteil, sondern als „Hier ist der Pfad, den du im Kopf suchst.“
Spaced Challenge
„Und dann?“, fragt Martin.
„Dann schickst du dieselbe Frage noch einmal – in drei Tagen. Und in sieben Tagen wieder. Ohne Hinweis, was die alte Antwort war.“
„Das klingt fies.“
„Es ist genial“, sage ich. „Weil das Gehirn lernt, dass es wichtig ist, diesen Pfad offen zu halten.“
So entsteht der Spacing Effect in Kombination mit Retrieval Practice – eine Art doppelter Dünger für das Langzeitgedächtnis.
Peer-Teaching Light
Für die dritte Ebene setzen wir auf Peer-Teaching Light.
Die Teilnehmer erklären sich gegenseitig einen Begriff oder ein Konzept – in zwei, drei Sätzen, aus dem Kopf.
Im Chat, im Forum oder live im Breakout-Room.
Martin ist skeptisch: „Machen die das mit?“
Ich nicke. „Wenn du es als Challenge rahmst – ja. Zum Beispiel: ‚Erkläre deinem Partner, was ‚Desirable Difficulties‘ sind – so, dass er es einer 12-Jährigen erzählen könnte.‘ Das bringt Humor rein – und schärft die Klarheit.“
Die erste Testwoche
Eine Woche später teste ich mit Martin den neuen Kursfluss.
Nach Modul 1 gibt es das Micro-Quiz. Die Teilnehmer sind überrascht – manche stöhnen kurz. Aber dann kommen die Antworten. Sofort-Feedback folgt.
Drei Tage später trudeln E-Mails ein: „Erinnerst du dich noch an…?“ – die Spaced Challenge.
Ein paar schütteln den Kopf, andere schreiben schnell drauflos.
Am nächsten Live-Call stellen wir fest: Die Antworten sind präziser. Weniger Lücken. Mehr Selbstvertrauen.
Messen, ob es wirkt
Wir setzen gemeinsam Metriken auf:
- Abrufquote: Anteil korrekt erinnerter Antworten nach dem zweiten Durchgang (+20 % im Vergleich zur ersten Runde).
- Transfer-Qualität: Wie gut sind die Projekt-Outputs nach Retrieval-Sequenzen?
- Drop-off-Rate: Bleiben mehr Teilnehmer bis zum Ende aktiv?
Nach vier Wochen sehen wir: Die Abrufquote steigt tatsächlich – und die Drop-offs sinken. Martins Teilnehmer bringen bessere Projekt-Outputs – sichtbar, messbar.
Humorvolle Nebenwirkung
Im Chat posten Teilnehmer jetzt kleine „Retrieval-Memes“: Bilder von neuronalen Autobahnen, von Gabelstaplern, die Wissen „hochheben“.
Es ist ein Running Gag geworden: Wer eine Frage nicht sofort beantworten kann, sagt: „Moment, mein neuronaler Pfad ist noch in der Baustelle.“
Und genau diese Leichtigkeit sorgt dafür, dass niemand Retrieval mit „Abfragen“ verwechselt. Es ist Training – nicht Prüfung.
Blueprint im Erzählfluss
Statt einer trockenen Liste erkläre ich Martin am Ende noch einmal die Essenz:
„Stell dir vor, dein Kurs ist ein Roman“, sage ich.
„Jedes Kapitel endet mit einer Szene, in der die Hauptfigur eine Frage beantworten muss – ohne ins Buch zu schauen.
Dann taucht diese Frage in späteren Kapiteln noch einmal auf – in einem neuen Kontext.
Und manchmal muss die Figur es einem anderen Charakter erklären.
Genau das ist Retrieval Practice.“
Martin lächelt. „Und am Ende erinnern sie sich, ohne zu wiederholen.“
„Genau“, sage ich. „Weil sie es schon hundertmal aus dem Kopf geholt haben.“
Sechs Wochen später, letzter Kurstag.
Die Teilnehmer präsentieren ihre Projekt-Outputs.
Tanja, die zu Beginn gestockt hatte, steht nun vor ihrer Kamera, erklärt den kompletten Projektplan, inklusive Risikostrategien – ohne auf ihre Unterlagen zu schauen.
„Weißt du, was das Beste ist?“, schreibt sie in den Chat.
„Ich hab gestern Abend den Plan meinem Mann erklärt – und er meinte: ‚Du klingst wie jemand, der das schon hundertmal gemacht hat.‘“
Martin liest das, lehnt sich zurück und weiß:
Das war der Moment, in dem Retrieval Practice seinen Kurs verändert hat.
Fazit
Wiederholen ist Streicheln. Retrieval ist Training.
Und wenn du beides mit den HELIX-Prinzipien in deinen Kurs einbaust – sofortige Anwendung, Feedback, Spacing – wird aus Wissen Können.