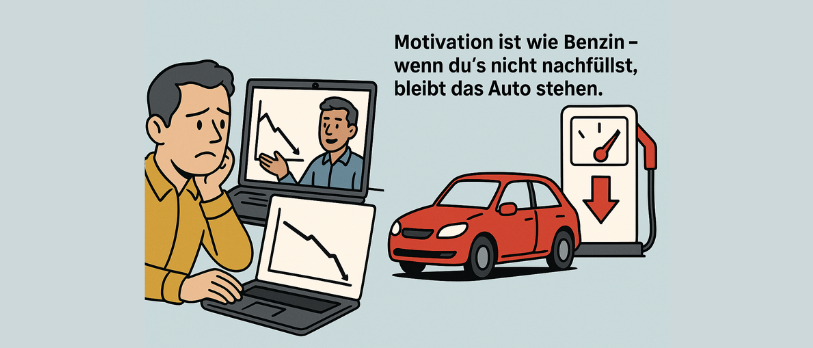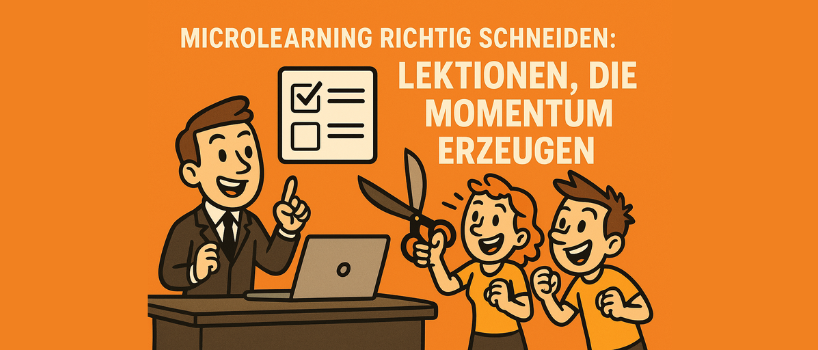Der Rucksack, der zu schwer war – und warum ich ihn nie wieder so packe
Es war spät. Der Bildschirm vor mir leuchtete in der Dunkelheit meines Arbeitszimmers.
Vor mir: die Gliederung für einen neuen Onlinekurs, den ich in den letzten Tagen akribisch entworfen hatte. 17 Module. 54 Lektionen. 128 Unterthemen.
Ich kannte das Spiel. Viele Trainer nennen so etwas „Mehrwert“.
Ich nannte es früher auch so.
Doch in dieser Nacht war da etwas, das an meinem Selbstverständnis kratzte.
Ich hatte die Zahl 128 eingekreist. Und während meine Hand den Stift hielt, hörte ich in meinem Kopf die Stimmen meiner früheren Teilnehmer:
„Ich hänge noch in Modul 3 fest…“
„Es ist alles spannend, aber ich komme nicht hinterher…“
Ich schob den Stuhl zurück und starrte auf meine Kurs-Gliederung …
„Was, wenn ich ihnen gerade den Rucksack gebe, der sie am Gipfel hindert?“
Die Bergsteiger-Regel
Ich habe in meinem Leben oft gesehen, wie Menschen mit Kursen starten wie Wanderer mit glänzenden Augen – und dann unterwegs aufgeben.
Nicht, weil sie nicht wollen.
Sondern weil ihr Rucksack zu schwer ist.
Diese Erkenntnis kam mir nicht in einem Seminarraum, sondern vor Jahren, bei einer echten Bergwanderung.
Ich erinnere mich an den Moment:
Ein Freund hatte alles eingepackt – drei Pullis zu viel, eine Flasche Wein, sogar ein Buch.
Am Anfang lief er vorneweg.
Nach der ersten Stunde hatte er den Spaß verloren.
Nach zwei Stunden musste er Pausen machen.
Vor dem letzten Anstieg gab er auf.
Nicht, weil der Berg zu steil war.
Sondern weil die Last ihn erdrückte.
Damals habe ich verstanden:
Es ist nicht der Weg, der scheitern lässt – es ist das Gewicht.
Und heute weiß ich: Für Kurse gilt genau das.
Jedes zusätzliche Unterthema ist wie ein weiteres Kilo im Rucksack. Jede extra Theorie ein zusätzlicher Stein auf dem Weg.
Und meine Teilnehmer würden den gleichen Weg gehen müssen.
Ich war nicht neu in diesem Geschäft. Ich hatte schon Hunderte von Stunden an Inhalten entwickelt, Menschen durch komplexe Prozesse geführt, Gruppen gecoacht.
Aber diese Liste vor mir fühlte sich nicht an wie ein Hilfsmittel.
Sie fühlte sich an wie Ballast und ich kannte die Forschung.
Das stille Gift: kognitive Überlastung
Die Lernpsychologie hat einen klaren Namen dafür: Cognitive Load Theory.
Unser Arbeitsgedächtnis kann nur 4–7 Informationseinheiten gleichzeitig halten.
Alles, was darüber hinausgeht, fällt herunter, bevor es ins Langzeitgedächtnis wandert.
Ich habe in meinen eigenen Programmen erlebt, wie das aussieht:
Zu viele Themen → Teilnehmer springen zwischen Lektionen.
Zu viele Details → Umsetzung bleibt liegen.
Zu viele „Nebenschauplätze“ → der rote Faden geht verloren.
Das Problem: Mehr Inhalt fühlt sich für den Trainer großzügig an – für die Teilnehmer ist es Ballast.
Die Entscheidung
Ich nahm das Notizbuch, blätterte zu einer frischen Seite und schrieb nur eine Frage auf:
„Was ist das eine Ziel dieses Kurses?“
Nicht drei Ziele. Nicht „so viel wie möglich“.
Ein Ziel.
Darunter schrieb ich: Was muss der Teilnehmer am Ende wirklich können oder erreicht haben?
Alles, was nicht direkt auf dieses Ziel einzahlte, flog raus.
Ohne Gnade.
Ohne Rücksicht auf meinen Stolz, dass ich es „auch noch weiß“.
Jedes Thema, das nicht direkt auf dieses Ziel einzahlte, gehörte nicht hierher.
Nicht jetzt. Nicht in diesem Kurs.
Ich begann zu streichen. Erst zögerlich, dann entschlossen.
Theorie Nummer acht? Weg.
Fallstudie Nummer fünf? Bonusmaterial.
Zusatzkapitel „Hintergrundwissen“? In die Ablage.
Was blieb, war … erstaunlich wenig.
Und das machte mir Angst.
War das jetzt zu wenig?
Würde der Kurs noch „wertvoll“ wirken?
Ich schob den Gedanken weg. Ich wusste, dass diese Angst nur mein Ego war.
Nicht die Realität, denn ich erinnerte mich an die Forschungen von Wolfgang Klafki.
Vier Werkzeuge, für zielführende Online-Kurse
Ich habe meine Inhalte seitdem immer durch vier Filter geschickt – und jedes Mal wurde der Kurs leichter und wirksamer.
1. Quantitative Reduktion – Übergepäck streichen
Alles, was nicht zwingend nötig ist, geht raus.
Früher: zehn Motivationstheorien. Heute: zwei, die sofort in die Praxis passen.
2. Qualitative Reduktion – Essenz statt Details
Wie beim Einkochen einer Brühe. Alles Überflüssige raus, der Geschmack bleibt.
Früher: jede einzelne SEO-Metrik. Heute: drei Prinzipien, die 80 % der Wirkung bringen.
3. Strukturelle Reduktion – Eine klare Karte zeichnen
Drei Schritte. Vier Phasen. Eine Route, die niemand verliert.
Früher: Module mit Sprüngen und Wiederholungen. Heute: glasklarer Lernpfad.
4. Situative Reduktion – Maßarbeit statt Standardware
Nicht „Marketing 101“. Sondern Marketing, das zu dieser exakten Zielgruppe passt.
Früher: Inhalte für alle. Heute: Inhalte für die, die ich wirklich erreichen will.
Mein HELIX-Sieb
Ich nenne es heute mein HELIX-Sieb, und jeder meiner Kunden lernt, damit zu arbeiten:
- Ziel definieren – Was muss der Teilnehmer am Ende können?
- Kernschritte identifizieren – Welche Inhalte sind dafür zwingend?
- Nice-to-know filtern – ab in den Bonusbereich.
- Transfer-Aufgabe entwickeln – sofort im eigenen Kontext anwenden.
- Iteration – Feedback sammeln, noch klarer werden.
Dieses Sieb trennt das Gold vom Geröll.
Und es zwingt dich, ehrlich zu sein: Ist dieser Inhalt wirklich nötig, oder will nur mein Ego ihn behalten?
Der Testlauf – und die Zahlen
Ich setzte den Plan um.
Aus 17 Modulen wurden 8.
Aus 54 Lektionen wurden 21.
Die Unterthemen schrumpften auf ein Drittel.
Ich betrachtet diese Zahlen und wusste: Der Rucksack war jetzt tragbar.
Die Wahrheit über Tiefe
Früher dachte ich: Tiefe entsteht durch Masse.
Heute weiß ich: Tiefe entsteht durch Raum.
Wenn der Kopf des Teilnehmers nicht mit Ballast vollgestopft ist, hat er Platz, das Wesentliche zu verarbeiten. Teilnehmer haben Zeit, es zu verarbeiten, auszuprobieren, darüber zu sprechen.
Das Gelernte wird Teil ihrer Realität – nicht nur eine Notiz in einem Kursportal.
Das Flussbett
Ich habe seitdem eine neue Lieblingsmetapher: den Fluss.
Ein Fluss wird nicht stärker, wenn man mehr Wasser hineinkippt.
Er wird stärker, wenn er in einem stabilen Flussbett fließt.
Zu viele Nebenarme – und die Kraft verpufft.
Meine Kurse sind heute wie ein Flussbett.
Breit genug, um zu tragen, schmal genug, um zu fließen.
Mein Rat für deinen nächsten Kurs
Wenn du das nächste Mal einen Kurs entwickelst, stell dir vor, du bist Bergführer.
Du willst, dass deine Leute den Gipfel erreichen.
Also packst du nur das ein, was sie brauchen, um oben anzukommen.
Alles andere ist Ballast.
Und Ballast ist der Feind von Umsetzung.
Denn am Ende zählt nicht, wie viel du gesagt hast.
Sondern wie viel deine Teilnehmer mitnehmen – und anwenden, sodass sie den Gipfel erreichen.